Mathematik/Sprache/Wissenschaft
Tagebücher der Wissenschaft

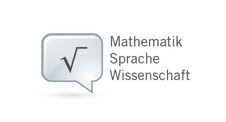 Wissenschaft ist ein Vorgang der Umformung – man findet Phänomene vor, man arbeitet sich denkend und experimentierend an ihnen ab und übersetzt seine Einsichten dann in Bilder und Begriffe. Die wiederum dienen als Grundlage für noch umfassendere Betrachtungen, oder als Startpunkt für die Erforschung immer neuer Phänomene.
Wissenschaft ist ein Vorgang der Umformung – man findet Phänomene vor, man arbeitet sich denkend und experimentierend an ihnen ab und übersetzt seine Einsichten dann in Bilder und Begriffe. Die wiederum dienen als Grundlage für noch umfassendere Betrachtungen, oder als Startpunkt für die Erforschung immer neuer Phänomene.
So bestimmt die Beschreibung ihrer Ergebnisse den Verlauf der Wissenschaft selbst, und zwei Kulturen ringen hier um die Deutungshoheit: Einige Wissenschaften schwelgen in Bildern und Worten, andere aber in Zahlen und Formeln. Welcher Weg ist der rechte? Wer bildet die Natur oder die Welt getreulicher ab, jene, die in Bildern reden, oder jene, die die Formel finden? Kommentare sind – wie immer – hochwillkommen.
Nur Relationen, nirgendwo Substanz |
Erfunden oder entdeckt? |
Wie die Physiologie zur Wissenschaft wurde |
Die Mathematik ist eine Sprache |
Die Wurzeln von Mathematik und Sprache |
Eine reichere Sprache als die natürlichen |
Die Wissenschaft als Erkenntnisprozess braucht die Mathematik |
Wissenschaft – ein Prozess der Symbolbildung |
Wie die Mathematik die Physik erschafft |
Mathematik – die Sprache der Religion? |










