Wie der Wind Tsunami-Trümmer (und abgetrennte Füße) über den Pazifik treibt
BLOG: Fischblog

Der Tsunami nach dem großen Erdbeben vor Japan am 11. März 2011 zerstörte nicht nur Küstenstädte und ein gewisses Atomkraftwerk, sondern riss auch unzählige Gegenstände und Trümmerteile ins Meer. Die japanische Regierung schätzt, dass etwa fünf Millionen Tonnen Trümmer im Meer landeten (pdf), von denen etwa 70 Prozent nahe der Küste im Meer versanken.
Die restlichen etwa anderthalb Millionen Tonnen, darunter dem Vernehmen nach komplette Schiffe, treiben als gewaltiger Trümmerteppich mit dem nördlichen Arm des Nordpazifikwirbels langsam nach Osten, auf die Westküste Nordamerikas zu. Ich hatte diesen Strömungstransport ja schon mal beschrieben, im Zusammenhang mit abgetrennten Füßen an nordamerikanischen Stränden. Lest euch den Beitrag kurz durch, ich erwarte auch diesmal wieder abgetrennte Füße. Der Punkt ist, dass Treibgut aus dem Westpazifik dank dieser Strömung eine gute Chance hat, irgendwann an der amerikanischen Westküste zu landen. Die interessante Frage ist halt nur, wann und wo.
Experten haben deswegen auch nicht vor etwa Anfang 2013 mit den ersten Trümmerteilen gerechnet: Der Wirbel ist mehr eine Drift als eine echte Strömung, so dass es schon mal zwei Jahre dauern kann, bis das Wasser den großen Ozean überquert hat. Aber das hat sich als Fehleinschätzung erwiesen: Schon im Januar 2012 berichteten die ersten Strandgutsammler von losgerissenen Fischerbojen, im April fand man einen Fußball an der Südküste von Alaska und im Juni tauchte dann sogar ein losgerissener Ponton vor Oregon auf – mehr als ein ganzes Jahr vor der erwarteten Ankunftszeit.
Der Grund dafür ist der Wind: Sie schwimmen gut und ragen über die Wasseroberfläche auf – damit bieten sie gute Angriffsfläche für die Westwinde dieser Breiten. Und das kann einen erheblichen Unterschied machen, wie diese Animation von Nikolai Maximenko und Jan Hafner von der Universität Hawaii zeigt.
Zum Vergrößern klicken. Quelle: Nikolai Maximenko & Jan Hafner, Universität Hawaii
Die Prozentzahlen beschreiben, nach allem was ich herausfinden konnte, den Anteil der Gesamtoberfläche des Treibguts, auf die der Winddruck wirkt. Die roten Punkte haben etwa fünf Prozent Fläche im Wind oder mehr, die violetten sind nahezu vollständig unter Wasser. So eine luftgefüllte Fischerboje ragt ein ganzes Stück aus dem Wasser, so dass grob geschätzt bis zu einem Viertel der Oberfläche als Segel wirkt, während ein Stück Treibholz weniger aus dem Wasser guckt und, sagen wir, ein Schuh mit abgetrenntem Fuß darin praktisch gar nicht. Fünf Prozent klingt nicht nach allzu viel, aber anscheinend reichen diese Unterschiede reichen aus, um die Trümmer auf ihrem Weg über den Ozean effektiv zu sortieren.
Die Animation zeigt denn auch ganz deutlich, dass der Wind nicht nur die Geschwindigkeit beeinflusst, sondern auch die Zeit, wo das Treibgut ankommt. Die leichtesten und schnellsten Objekte bilden sogar einen separaten Wirbel vor der Küste von Alaska – je tiefer allerdings ein Gegenstand im Wasser liegt, desto stärker ist der Einfluss der Strömung, und die biegt anders als der Wind vor der Küste nach Süden ab. Je später also die Trümmer an der Küste ankommen, desto weiter nördlich tauchen sie auf.
Ich hatte ja in meinem Beitrag über die abgetrennten Füße die Hypothese aufgestellt, dass einige von ihnen von aufs Meer hinausgezogenen Tsunami-Opfern des Jahres 2004 stammen. Entsprechend vermute ich, dass auch in der Folge des chinesischen Tsunamis solche makaberen Funde auftauchen werden. Allerdings ragen Füße in Turnschuhen kaum allzu weit über die Wasseroberfläche hinaus, so dass ich mit solchen Meldungen tatsächlich erst etwa Anfang 2013 rechnen würde – irgendwo in Oregon oderNordkalifornien.


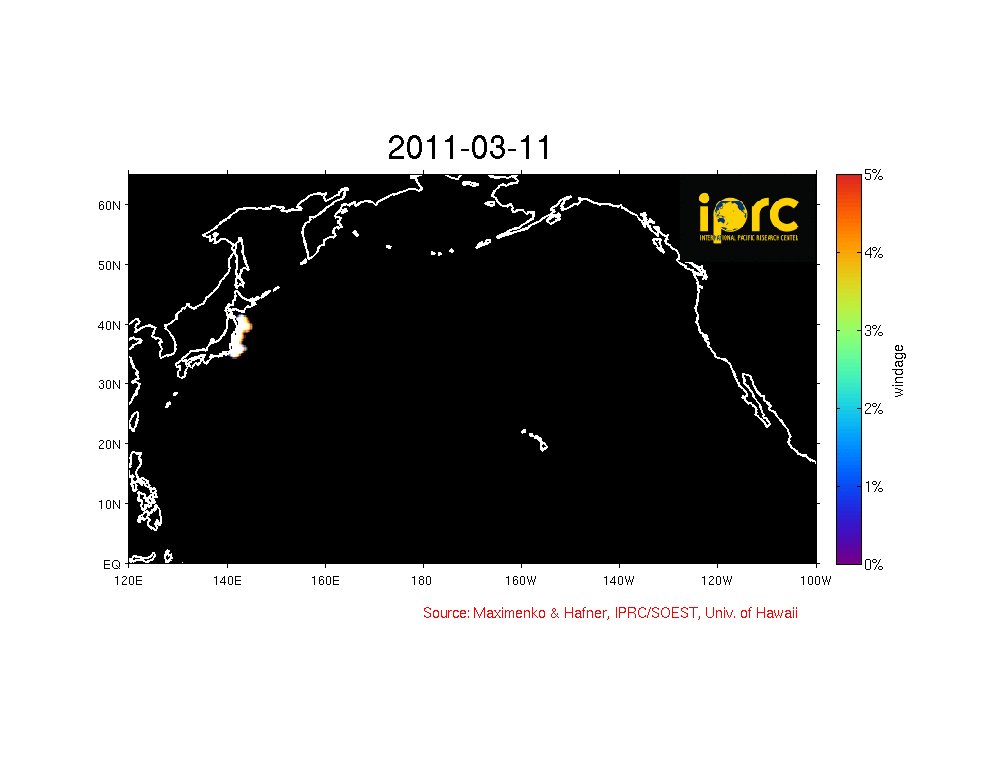
Off on a tangent
Ich klinke mich hier mit einem völlig anderen Gedanken ein. Nicht, weil ich zynisch bin und die vom Tsunami zerstörten Leben und Existenzen mich nicht berühren. Im Gegenteil, gerade weil es mich berührt, will ich mich jetzt nicht damit beschäftigen, wie 25000 Menschen von einer 12 Meter hohen Wand aus Wasser aus ihrem kleinen, alltäglichen Leben gerissen werden.
Also nutze ich die Gelegenheit zu einem Blick in die Zukunft und picke mir dazu aus dem obigen Artikel nur die Geschwindigkeit heraus, mit der Objekte an der Meeresoberfläche unter dem kombinierten Einfluss von Stömung und vorherrschenden Winden den halben Globus überqueren.
In diesem Zusammenhang fallen mir Vorschläge für fernüberwachte, weitgehend autonome Fischfarmen ein. Diese bestehen eigentlich nur aus riesigen, demontierbaren Käfigen. In diese wird auf R3ede vor dem Abfahrtsort (beispielsweise an der Ostküste Japans) Fischlaich in nochmals kleineren, engmaschigeren und sich später ferngesteuert öffnenden eingebracht. Dann wird das ganze einfach freigegeben und schwimmt langsam über den Pazifik davon.
Plankton und Kleintiere, von denen sich die Jungfische ernähren, kommen problemlos durch die Gitterstäbe, Raubfische, Wale und Robben dagegen nicht. Über Satellitennetzwerke sendet jede autonome Fischfarm Telemetrie zur Basisstation irgendwo auf der Welt, von wo aus sie gesteuert wird. Viel zu steuern gibt es aber nicht, denn so eine Farm hat keinen Antrieb, allenfalls ein lenkbares Segel.
Wie man aus den obigen Grafiken sieht, führt der vom Wind und der Drift getriebene Weg recht weit nördlich, wo das Wasser sauerstoff- und nährstoffreich sein dürfte. Nach Monaten der Reise kommt die Farm in Küstennähe, diesmal an der anderen Seite des Ozeans, also hier an der Westküste Amerikas. Dort können die mittlerweile ausgewachsenen Fische geerntet, und die schwimmenden Farmen auseinandergebaut, gewartet und dann aufs Schiff verladen werden, um nach Asien zurückgeschickt zu werden.
Auch ein Teil ihrer Fracht wird die Rückreise antreten, diesmal aber im Bauch eines Kuhlschiffs.
Dies wäre eine Idee, um die Meere zur Nahrungsgewinnung zu nutzen, ohne der Überfischung weiter Vorschub zu leisten. Da die in solchen Farmen gezogenen Fische natürliches Futter fressen und in einem weitgehend natürlichen Habitat leben, wird die Qualität des Fischfleischs höher als bei jetzigen Fischfarmen. Medikamente werden beispielsweise gar nicht gebraucht.
Auch in punkto Kosten dürften solche autonomen Hochseefarmen Vorteile bringen, denn sie müssen nicht konstant bewirtschaftet werden; es fallen keine Kosten für Reinigung des Wassers, für Futter und Medikamente an und nur geringe für Personal und für eine kleine Eingreifflotte, die bei aktuten Problemen vor Ort sein muss.
Eine zentralen Rolle kommt der Satellitentechnik zu, bei der Datenübertragung und der Überwachung per Radar.
Die Sache hat einen Haken:
Die Fische, die man ökonomisch in solchen Farmen halten kann, sind Raubfische, die in einem solchen Käfig nicht genug Nahrung finden. Deswegen muss man da zufüttern.
Mit kleinen Planktonfressern würde die Idee funktionieren, aber diese Fische sind nicht hochwertig genug, dass es sich lohnen würde, sie zu farmen.
Aber es gibt auch Rechtliche Probleme
Denn jedes Schiff, Jeder Zuchtkäfig, der außerhalb der Hoheitsgewässer der jeweiligen Staaten treibt, gilt als Seefund. Selbst mit GPS-Verfolgung wird es schwierig sein, abgeborgene Zuchtstationen wieder aufzufinden, wenn Dritte sie aufgenommen haben.