Wissenschaft als teures Hobby – eine Rezension zum Buch: #IchBinHanna
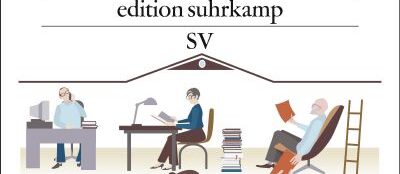
Die Initiator*innen von #IchBinHanna erreichten innerhalb nicht einmal eines Jahres über 135.000 Tweets,[1] nun haben sie eine “Streitschrift“ (Suhrkamp-Verlag) vorgelegt. Damit wollen sie ein traditionelleres Publikum erreichen. Kann Ihnen dies gelingen? Eine Rezension zum Buch #IchBinHanna. Prekäre Wissenschaft in Deutschland.
Um es vorwegzunehmen: Dafür dürften sie gute Chancen haben. Denn das Buch bietet in verständlicher Sprache und in drei Teile klar gegliedert einige im öffentlichen Diskurs bisher wenig ausgeleuchtete Einsichten: So enthält Teil 1 eine historische Rekonstruktion unter Einschluss der Rolle wesentlicher Protagonisten zur Frage: Wie kam es zur gegenwärtigen Situation? In Teil 2 beschreiben die Autor*innen nicht nur die Beschäftigungsbedingungen des befristeten wissenschaftlichen Personals, sondern auch die Auswirkungen auf das und Zusammenhänge mit dem deutschen Wissenschaftssystem als Ganzem. In Teil 3 diskutieren sie Lösungsvorschläge und Reformansätze.
Auf den Punkt gebrachte Formulierungen und zugleich argumentative Potenziale
Nachfolgend möchte ich in meiner Rezension zum Buch #IchBinHanna exemplarisch ein paar Inhalte aus den Teilen vorstellen, die mir wesentlich erschienen, und die mir ob ihrer auf den Punkt gebrachten Formulierungen gefallen.
Für den vorderen Teil des Buches möchte ich stellvertretend nennen, wie sie mit der ersten Reaktion der Hochschulrektorenkonferenz umgingen: Am 23. Juni 2021 hatte deren Vizepräsidentin Kerstin Kriegelstein in der „ZEIT“ argumentiert, sie sehe „keine Alternative“ zum System der generellen Befristungen. Die #IchBinHanna-Initiator*innen halten ihr im Buch entgegen: Die Absurdität dieser angeblichen Alternativlosigkeit werde schnell offensichtlich, wenn man versucht, dies Menschen in der freien Wirtschaft zu erklären (S. 19).
Dies hat mir gefallen, denn damit haben sie in wunderbar prägnanter Weise ein Prinzip der Hochschulforschung angewandt, nämlich „die Problemhorizonte der Hochschulentwicklungsakteure zu erweitern bzw. zu überschreiten“ (Pasternack 2006, S. 108). Zugleich möchte ich in dieser Rezension zum Buch #IchbinHanna aber hierfür und für ein paar folgende Argumentationen aufzeigen, dass deren Potenziale für die weitere Diskussion mittels Einbezug von Ergebnissen empirischer Forschung noch gestärkt werden könnten. So blieb hier in der Entgegnung der Autor*innen die Möglichkeit ungenutzt, Ergebnisse der Hochschulforschung zu den Anteilen befristet Beschäftigter in beiden Sektoren gegenüberzustellen. Diese sind geradezu gegensätzlich und liegen in der Privatwirtschaft in Forschung und Entwicklung bei 9 Prozent, für Nachwuchsforschende in der Wissenschaft (also im öffentlichen Dienst) dagegen bei 92 Prozent. Seit Einführung des Wissenschaftszeitvertragsgesetztes ist letzterer Anteil damit entgegen von der Bundespolitik formulierten Zielen nicht gesunken, sondern fast kontinuierlich gestiegen (vgl. Bundesberichte zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs – BuWiN 2021, 2017, 2013, 2008, Überblick in Krempkow 2020).
Wie kam es zur gegenwärtigen Situation?
Im Teil 1 arbeiten die Autor*innen dann heraus, dass die heute dominanten Überzeugungen (wie die o.g. von Kriegelstein geäußerte) dies keineswegs schon immer waren; und wer diese zuerst formuliert und durchgesetzt hat, bis sie schließlich im WissZeitVG in Gesetzesform gegossen wurden (S. 31ff.). Vielmehr habe der Wissenschaftsrat 1960 einen Nachwuchsmangel konstatiert und zur Schaffung neuer (Dauer-)Stellen aufgerufen, statt etwa zur Teilung oder Befristung vorhandener Stellen (S. 34). Das änderte sich dann ab Mitte der 70er Jahre, indem der Wissenschaftsrat deutlich Position für mehr befristete Stellen bezog.[2] Dies ging einher mit einer neuen Rhetorik, „die Promovierte zunehmend infantilisierend als primär in der Qualifikation befindliche Personen definiert (…), nicht als Mitarbeiter*innen mit anspruchsvollen Aufgaben“ (ebd.). Aber auch die Westdeutsche Rektorenkonferenz (Vorläufer der HRK) und insbesondere die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) sprachen sich seit den 70ern für diesen Weg aus. Bereits damals fand sich in den MPG-Verlautbarungen das Argument, einzig neue Mitarbeiter*innen könnten neue Problemstellungen bearbeiten (S. 35). Diese Formel sei bis heute aktuell, obwohl sie – wenn sie zuträfe – gerade für die unbefristeten Professor*innen wenig schmeichelhaft ist. Zu deren Durchsetzung habe nicht zuletzt auch die personelle Verflechtung auf den Leitungsebenen der wissenschaftlichen Großorganisationen beigetragen: So war z.B. der Astrophysiker Reimar Lüst zunächst Gründungsdirektor eines MPI, bevor er Anfang der 70er Vorsitzender des Wissenschaftsrates und anschließend bis in die 80er MPG-Präsident war (ebd.).
Diese historische Rekonstruktion unter Einschluss der Rolle wesentlicher Protagonisten ist nicht nur sehr hilfreich für die Nachvollziehbarkeit, wie es zur gegenwärtigen Situation kam. Sie kann darüber hinaus – bei in den letzten Jahren wieder beobachtbarer personeller Verflechtung auf den Leitungsebenen der wissenschaftlichen Großorganisationen insbes. der „Allianz der Wissenschaftsorganisationen“ – nützlich sein für das Verständnis, inwieweit Machtpositionen einzelner Personen Entwicklungen im Wissenschaftssystems beeinflussen und ggf. Weiterentwicklungen behindern können. Vielleicht sollte hier auch über eine Begrenzung der Machtfülle nachgedacht und – ähnlich wie bei anderen Präsidentschaften – maximal 2 Amtszeiten erlaubt werden (alle Großorganisationen einberechnend). Dies könnte ein flankierender Lösungsvorschlag zusätzlich zu den in Teil 3 des Buches genannten sein.
Wissenschaft in Deutschland „nichts für Leute, die sie sich nicht leisten können“
In Teil 2 fand ich die Formulierung besonders prägnant und treffend: „Wissenschaft ist in Deutschland nichts für Leute, die sie sich nicht leisten können. Sie ist über viele Jahre eher ein teures Hobby für Menschen mit finanziellem Polster…“ Dies bringt die Problematik der sozialen Selektivität anstelle vorgeblicher Leistungsselektivität auf dem Weg zur Professur in zwei Sätzen auf den Punkt. Allerdings könnte auch dies mittels Einbezug von Ergebnissen empirischer Forschung noch gestärkt werden.[3] Kurz zusammengefasst lässt sich nämlich aufgrund empirischer Studien sagen, dass Nichtakademikerkinder im Vergleich zu Akademikerkindern zuletzt eine dreifach geringere Chance hatten, einen Doktortitel zu erwerben (vgl. Scilogs-Beitrag vom 2.11.2021). Und diejenigen Nichtakademikerkinder, die den Doktortitel erwarben, haben dann wiederum eine rund vierfach geringere Chance auf eine Berufung. Nach den letzten verfügbaren Zahlen ist der Zugang zur Professur im Zeitvergleich damit so sozial selektiv wie nie in den letzten 50 Jahren.
Damit einher geht, und dies wird im Buch ebenfalls klar benannt, dass das deutsche Wissenschaftssystem zwar eines der teuersten, aber gemessen an seiner seit einigen Jahrzehnten dominanten Logik von Wettbewerb, Innovation, Publikations- und Zitationsoutput keines der weltweit besten ist. Zur Ineffizienz wesentlich bei trage allerdings wiederum das Befristungs(un)wesen: Eine von deren Folgen für die Wissenschaft sei nämlich, dass in kurzer Folge immer wieder neu eingestellte Personen eine gewisse Einarbeitungszeit brauchen, die außerhalb der Wissenschaft häufig auf ca. ein Jahr angesetzt wird. Diesen Hinweis sehe ich ebenfalls als sehr wertvoll; allerdings ließe sich diese Überlegung mit Hilfe empirischer Studienergebnisse noch weiterführen: Denn nach letzten Erhebungen beträgt die durchschnittliche Vertragslaufzeit etwa zwei Jahre (vgl. BuWiN 2021, Krempkow 2020). Demnach wäre die genannte Einarbeitungszeit bereits etwa die Hälfte davon![4]
Ginge man hier grob von einer Produktivität von 50% oder 65% über die gesamte Vertragslaufzeit aus (entsprechend der Argumentation vieler Befristungsbefürworter, dass Qualifikand*innen ihrer Qualifikation entsprechend nur 50% oder 65%-Teilzeitstellen erhalten), so wäre im ersten Vertragsjahr rein rechnerisch nur mit einer sehr geringen bis gegen Null gehenden Produktivität zu rechnen. Selbst wenn diese Überschlagsrechnung u.a. aufgrund höherer als unterstellter Qualifikation sowie massiver unentgeltlichen Mehrarbeit nicht ganz zutreffen dürfte (was oft auch auf Missachtung von Arbeitszeitgesetzen beruht, z.B. Wochenendarbeit ohne Arbeitszeitausgleich, sowie vorgeschriebene Ruhezeiten nach Nachtarbeit), so bleibt eine enorme Ineffizienz durch die erzwungene Fluktuation.[5] Hier können dies nur durch das Buch angeregte erste Überlegungen sein. Es wäre für eine umfassende Folgenabschätzung m.E. wichtig, die Fluktuationskosten von hierfür Ausgewiesenen, z.B. Wirtschaftswissenschaftler*innen, komplett durchzurechnen und den angeblich von den Hochschulen und Forschungsinstituten nicht tragbaren zusätzlichen Kosten des entfristeten Personals gegenüberzustellen (die v.a. die mit den Jahren höher werdenden Erfahrungsstufen im TV-L bzw. TVöD betreffen).
Forschende als egozentrische Karriereoptimierer?
Ein weiterer sehr wichtiger im Buch als Folge der aktuellen Situation angesprochener Aspekt ist die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit. Die Autor*innen weisen darauf hin, dass insbesondere befristet Forschende sich im Interesse ihrer (vorläufigen) Verbleibchancen gezwungen sehen, ihre Forschungsthemen und methodischen Ansätze an wissenschaftsfremden Gesichtspunkten auszurichten. Zu welchem Thema geforscht wird, mit wem sich vernetzt wird und wem nicht, welche Fragestellungen riskant sein und das eigene Fortkommen gefährden könnten – solche Entscheidungen würden vorrangig unter einer egozentrischen Sichtweise getroffen (werden müssen, um unter vorgegebenen Rahmenbedingungen Karriere- bzw. Verbleibchancen zu optimieren). Auch hierzu gibt es empirische Fakten, die dies nicht nur als (wenngleich plausible) Behauptung erscheinen lassen, sondern die die Argumentation noch stärker fundieren könnten: Einer bundesweit repräsentativen Wissenschaftlerbefragung zufolge nimmt selbst die i.d.R. verbeamtete deutsche Professorenschaft bereits seit längerem einen hohen Druck zur Einwerbung von Drittmitteln wahr, so dass Forschung ohne Drittmittel für viele kaum möglich ist: Bereits vor etwa einer Dekade gaben nur 18% der Professor*innen an, auch ohne Drittmittel ihren Forschungsfragen nachgehen zu können (vgl. Krempkow 2021). Seitdem wurde der Drittmitteldruck nicht geringer.
Allerdings gilt dies keineswegs für alle Forschenden und nicht für alle Fächergruppen gleichermaßen.[6] Es gibt glücklicherweise auch solche, die unbeirrt riskante Fragestellungen angehen. Dies zeigte schon der enorme Zuspruch z.B. zur „Experiment“-Förderlinie der Volkswagen-Stiftung (vgl. Barlösius & Philipps 2021, in: Qualität in der Wissenschaft – QiW). Solche Forschende mittels mehr – auch staatlicher – Förderinitiativen stärker zu unterstützen, könnte demzufolge ein zusätzlicher Lösungsvorschlag sein.
Es geht nicht nur um Arbeitsbedingungen, es geht um die Grundpfeiler der Wissenschaft
In Teil 3 haben es die Autorinnen vermocht, nicht nur die bisher diskutierten Lösungsvorschläge zusammenzutragen, sondern auch prägnant zu synthetisieren: Demnach „führt kein Weg an einer großen Reform vorbei, die an mehreren Punkten ansetzen muss. Neben dem Befristungsrecht[7] müssen insbesondere die Finanzierung,[8] die Personalstruktur[9] und die Rekrutierung[10] von Grund auf neu zugeschnitten und aufeinander abgestimmt werden. (…) Die Kunst besteht also darin, mit Fachkompetenz und viel diplomatischem Geschick eine umfassende Reform zu erarbeiten und breite Unterstützung für ihre Umsetzung zu mobilisieren.“
Ihre einzelnen konkreten Forderungen,[11] denen eine Reform des deutschen Wissenschaftssystems in jedem Fall genügen sollten, sind (hier von mir kurz zusammengefasst):
- Promotionen auf 100%-Stellen;
- Vielfalt von Stellenprofilen anstelle Professur als vermeintlichem Zentrum der Wissenschaft;
- Bestenauslese im Wissenschaftssystem, die diesen Namen verdient;
- Sicherung der Expertise von Wissenschaftler*innen in der Wissenschaft selbst.
Mein Fazit dieser Rezension zum Buch #IchBinHanna. Prekäre Wissenschaft in Deutschland: Es ist eine durchweg lesenswerte und sehr gut lesbare Zusammenfassung der Diskussion der letzten Jahre um Befristungen in der Wissenschaft in Deutschland, ihrer historischen Entwicklung und Folgen sowie von Lösungsvorschlägen und Reformansätzen. Lediglich in Hinblick auf die Fundierung einiger Argumentationen mit empirischen Studien ist noch etwas Luft nach oben.
Das Buch: Amrei Bahr, Kristin Eichhorn & Sebastian Kubon: #IchBinHanna. Prekäre Wissenschaft in Deutschland. Suhrkamp Verlag, 2022. ISBN 978-3-518-02975-6, 144 Seiten, 13€.
_____________________________________________
[1] Dies entspricht der zum Erscheinungszeitpunkt genannten Zahl. Zudem wurden einige wesentliche ihrer Forderungen in den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung aufgenommen. Wenngleich einige der Forderungen freilich schon länger existieren (so u.a. formuliert von GEW, Mittelbauinitiativen und dem Netzwerk für Promovierende und Promovierte Thesis e.V.), verschaffte #IchBinHanna ihnen via Twitter neue bzw. größere Resonanz.
[2] Fairerweise ist hierzu zu ergänzen, dass die sich in den folgenden Jahrzehnten bis heute vollziehende Fehlentwicklung zwischenzeitlich erkannt wurde und sich der Wissenschaftsrat (2014) mit der insbes. von der Abteilungsleiterin Tertiäre Bildung, Sabine Behrenbeck, vorangetriebenen Empfehlung (Drs. 4009-14) korrigierte. In dieser wurden – rund 40 Jahre später – deutlich mehr unbefristete Stellen gefordert.
[3] Zugunsten der Buch-Autor*innen möchte ich erwähnen, dass der offizielle Bundesbericht zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs (BuWiN 2021) es ihnen nicht leicht macht: Denn obwohl ein Schwerpunktthema „Chancengerechtigkeit“ lautete, finden sich darin über die Kategorie Geschlecht hinaus, so z.B. bezogen auf eine Herkunft aus dem Ausland, sowie bezogen auf die soziale Herkunft (insbes. Bildungsherkunft, also Nichtakademikerkinder), sowie Menschen mit Behinderung nur wenige Aussagen, geschweige denn eine durchgehende Differenzierung der Ergebnisse zumindest zu den zentralen Indikatoren (vgl. auch Scilogs-Beitrag vom 19.2.2021). Dies gilt trotz Vorliegen von Studien mit entsprechenden Ergebnissen (vgl. insbes. Möller 2018, Zimmer 2018, Stifterverband 2017, Überblick in Krempkow 2019, 2021).
[4] Selbst wenn man davon ausginge, dass inzwischen alle Hochschulen eine Mindestvertragslaufzeit von z.B. drei Jahren für Qualifikationsstellen einhalten würden (was nach bisherigen Erfahrungen mit freiwilligen Selbstverpflichtungen unwahrscheinlich ist), wäre dies immer noch ein Drittel der Vertragslaufzeit.
[5] Hierbei wurden zunächst nur Lehre und Forschung betrachtet. Die zusätzlich vom wissenschaftlichen Personal zu leistenden Bewerbungs- und Einstellungsprozesse usw., die sich aufgrund der meist sehr konservativen Auslegung der Personalabteilungen bzgl. „Entfristungsrisiko“ als oft sehr zeit- und nervenraubend gestalten, sind hier noch nicht mit eingerechnet. Für die Privatwirtschaft wurden direkte und indirekte Fluktuationskosten pro Fluktuationsfall von ca. 43.000€ (Mindestkosten) ermittelt. Dies entspräche an Hochschulen etwa dem Brutto einer 80%-Stelle (E13) für 1 Jahr.
[6] Die Notwendigkeit, eine Finanzierungsquelle für die Umsetzung von Forschungsideen zu finden, gilt insbes. für die Lebenswissenschaften wie für experimentelle Naturwissenschaften, und dies in ähnlich starker Weise. Dagegen trifft dies z.B. für die Geisteswissenschaften und die Wirtschafts-/ Sozialwissenschaften deutlich weniger zu, aber auch dort immer noch für etwa die Hälfte. Diese Angaben korrespondieren mit der bekannten unterschiedlichen Drittmittelintensität der Fächer (ausführlicher vgl. Krempkow 2021).
[7] Vgl. auch Scilogs-Beitrag vom 28.1.2016.
[8] Vgl. auch Scilogs-Beitrag vom 22.6.2020.
[9] Vgl. auch Scilogs-Beitrag vom 22.9.2016 und den vom 12.10.2017 sowie 3.10.2018.
[10] Vgl. auch Scilogs-Beitrag vom 8.3.2018.
[11] Die Forderungen decken sich in wesentlichen Teilen mit denen von z.B. GEW, Mittelbauinitiativen und Thesis e.V.. An den Forderungen letzterer Organisation wirkte ich selbst mit.


In einer ZDF-Sendung ´Maithink X´ wird die #IchBinHanna-problematik sehr gut dargestellt
Danke für den Hinweis – und ja, dort wird es in der Tat auch sehr gut dargestellt und zusammengefasst. Das vorgestellte Buch bietet darüber hinaus noch einiges zusätzlich an Hintergründen und Ansatzpunkten zur Verbesserung der Situation, wovon ich ja exemplarisch eine kleine Auswahl vorstellte.
Danke für diese interessante und sehr gut empirisch unterbaute Rezension.
Ich meine mich aber daran zu erinnern, in deinem Blog hätte einmal gestanden, nur 1 von 100 Doktoren/Doktorinnen komme aus einem nicht-akademischem Haushalt. Irre ich mich? Oder wie verhält sich das zum hier genannten Drittel?
Hallo Stephan, Danke, es freut mich, dass Dir die Rezension gefällt!
Und was das vor nunmehr fast fünf Jahren berechnete Zahlenverhältnis betrifft, wonach nur 1 von 100 Doktoren/Doktorinnen aus einem nicht-akademischem Haushalt kommt, so hat sich dies nach einer jüngst vorgelegten Neuauflage dieser Berechnungen erfreulicherweise ein klein wenig verbessert: Es sind jetzt 2 von 100 Doktoren/Doktorinnen aus einem nicht-akademischem Haushalt (siehe Scilogs-Beitrag vom 2.11.2021).
Die Verbesserung ist größtenteils auf die dort ausgewiesene nun höhere Übergangsquote vom Master zur Promotion für Nichtakademikerkinder zurückzuführen. Allerdings steht eben diese im Gegensatz zur Tendenz mehrerer anderer Studien (Überblick in Krempkow 2019 bzw. Kurzfassung hier auf Scilogs). Es ist daher zu vermuten, dass diese Übergangsquote vom Master zur Promotion, bei der nun eine andere als die in der Vorgängerberechnung verwendete Quelle verwendet wurde, nicht wirklich vergleichbar ist, und die Erhöhung v.a. darauf zurückzuführen ist.
Da die Grundaussage der 2 oder 1 von 100 aber letztlich (fast) dieselbe ist und ich mit meinem kleinen Blog wohl kaum dieselbe Reichweite erzielen werde wie der Stifterverband mit seiner gut ausgestatteten Kommunikationsabteilung, habe ich mich in meinem jüngsten Blogbeitrag auf die Chancenrelation der Nichtakademikerkinder im Vergleich zu Akademikerkindern über alle Bildungsabschlüsse bezogen. Die ist ja immer noch ungleich genug, so dass hierbei die letzte Übergangsquote gar nicht soviel ausmacht.