“Realistischer sollten die ‘Realisten’ sein”
BLOG: WIRKLICHKEIT

Rezension zu Frank Vogelsang (2011), Offene Wirklichkeit, Karl Alber: Freiburg/Br, €29,00.
Ich möchte das kürzliche Erscheinen der ersten Monographie meines Freundes und Kooperationspartners bei nunmehr schon fünf spannenden Neuroethik-Foren an der Evangelischen Akademie im Rheinland (Bonn/Bad Godesberg), Frank Vogelsang, zum Anlass für eine kleine Reihe von Blog-Beiträgen mit Rezensionen zu neueren Büchern nehmen, deren Gemeinsamkeit darin besteht, den Titel meines Brainlogs WIRKLICHKEIT ihrerseits im Titel zu führen.
„Offene Wirklichkeit – Ansatz eines phänomenologischen Realismus nach Merleau-Ponty“ betitelt der evangelische Theologe und Elektroingenieur (nota bene!) seine über 400 Seiten starke Kritik an einer zunehmend einseitig an naturwissenschaftlich-technischem Denken und der Dinglichkeit der Welt orientierten Sicht der Wirklichkeit („Realismus“; lat. res, das Ding) sowie einer wachsenden Dominanz naturalistischen Denkens in der Philosophie.
Das naturwissenschaftliche Denken zeichnet sich durch die (virtuelle) Ausblendung des Beobachters aus, der von sich absieht und seine Erkenntnisse durch die exakte und nachvollziehbare Beschreibung der eingesetzten Methoden von sich selbst als individueller Person unabhängig zu machen trachtet. Naturalismus nenne ich diejenige Denkrichtung, die glaubt, aus der Naturwissenschaft in direkter Übersetzung Philosophie machen zu können. (Sie ist aber keinesfalls die einzige Philosophie, die die Errungenschaften moderner Wissenschaft zu würdigen weiß.)
Vogelsang erblickt in der naturalistischen Tendenz, nur der (popularisierten) Naturwissenschaft Vernunft und Wahrheit zuzutrauen und die an Personen gebundenen Erscheinungsweisen des Wirklichen in die Sphäre des bloß Subjektiven abzuschieben, eine folgenreiche Verflachung unserer Sicht und – wichtiger noch – unserer Erwartungen gegenüber der Wirklichkeit: „Wenn es uns gelingt, die Wirklichkeit, auch die, die sich gerade in diesem Moment vor unseren Augen ausbreitet, als in den Grundfesten unverstanden wahrzunehmen, mag auch wieder eine Kultur der Neugierde und der Offenheit entstehen“ (S. 15). Der Theologe charakterisiert die heute dominante Weltsicht wie folgt: „Der Mensch ist ein körperliches Wesen mit einem Innenleben. Er ist in gewisser Weise ein in seinem Körper eingekapseltes Wesen. Die Welt ist ein durch Raum und Zeit strukturiertes Gesamt von Objekten, die zueinander in Beziehungen stehen. Zu diesen Objekten gehört auch der Mensch.“ (S. 17) Die Vorstellung, dass die Welt der Dinge (einschließlich des Organismus des Menschen selbst) dem Menschen als wahrnehmendem und denkendem Wesen völlig getrennt gegenüber steht, verbindet sich in unseliger Weise mit dem durch die populärwissenschaftliche Literatur befeuerten Gefühl, dass wir die Welt im Grunde bereits durchschaut hätten, was sich an den technischen Errungenschaften ja zweifelsfrei ablesen lasse.
Folgerichtig beginnt Vogelsang seine Überlegungen mit einer Rélecture der Meditationes de prima philosophia des französischen Philosophen René Descartes (1596-1650) und der Trennung der Wirklichkeit in res extensa und res cogitans: Im cartesischen Sinne sind Beobachter und Beobachtetes zwei grundverschiedene Dinge, die nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. In einer cartesischen Welt gehen die Dinge uns letztlich nichts an, sie wollen nichts von uns wissen, sie sind entseelt. Und wir werden uns selbst zu einem entseelten Ding, das uns nichts angeht und das von uns nichts wissen will. Naturalistische Weltbeschreibungen changieren daher in eigentümlicher Weise zwischen Weltbejahung und Weltverneinung; denn da das evaluative Urteil im menschlichen Denken unvermeidlich ist, muss der philosophische Versuch einer aktiven Vermeidung dieses Urteils durch Beschränkung auf Fakten entweder naiv-utopische oder zynisch-nihilistische Züge annehmen. Die moderne neurokognitive Bewusstseinsforschung erscheint trotz anders lautender Beteuerungen in der cartesischen Tradition befangen, wenn sie das Bewusstsein (den Geist, das Mentale etc.) als eine weitere Sache in der Welt betrachtet, die es unter bestimmten Umständen auch noch gibt. Diese Zusammenhänge erläutert Vogelsang in einem weiteren Kapitel, in dem er sich kritisch mit dem Naturalismus des amerikanischen Philosophen Daniel C. Dennett (*1942) auseinandersetzt.
Der Autor möchte in den nun folgenden Kapiteln ausloten, wie über Wirklichkeit zu sprechen wäre, wenn wir die ursprüngliche und unauflösliche Verflechtung zwischen dem Menschen als wahrnehmendem Subjekt – der ja im eigentlichen Sinne nur darin existiert, dass er die Welt und sich darin wahrnimmt – und ebendieser der Welt – die ebenfalls im eigentlichen Sinne nur ist, insofern sie sich zeigt – als Basis allen Denkens und jedweder Erkenntnis akzeptiert. Der Begriff Wirklichkeit impliziert – in Unterscheidung vom Begriff einer vom Beobachter getrennten Welt – diese ursprüngliche Verbindung: Wirklichkeit also nicht als bloßes Vorhandensein von etwas, sondern als ein ursprüngliches sich Zeigen.
Die Schwierigkeit dieser Unternehmung besteht nun darin, die Phänomenologie dieses ursprünglichen Erlebens nicht in einer diffusen, irrationalen oder solipsistischen Weise ins Spiel zubringen – schon gar nicht als Affront gegen das naturwissenschaftliche Denken –, sondern eher als eine einladende, den Blick weitende Erinnerung an den Erkenntnisgrund auch naturwissenschaftlicher Wahrnehmung sowie an den viel weiteren Horizont und den ungeheuren phänomenalen Reichtum des überhaupt Erfahrbaren. Der quasi ortlose Blick des Naturwissenschaftlers, der sich die verdinglichte Welt wie von außen her beobachtend aneignet und sie sich durch distanzierte Beobachtung zugleich vom Leibe hält – als blicke er durch ein Bullauge auf sie – ist nicht der ursprüngliche und vor allem nicht der einzig sinnvolle Standpunkt des Menschen im Verhältnis zur Welt; vermutlich ist dieser utopische Standpunkt gar kein Ort der Sinnfindung. Der Eindruck, dass der Naturwissenschaftler eine quasi-göttliche Perspektive einnehmen und die Welt wie von außen her betrachten kann, kann ohnehin ausschließlich dann entstehen, wenn die Methodenbindung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ignoriert wird – also in der Popularisierung von Naturwissenschaft als Weltbild, wie wir sie in Zeitungen, vielen sogenannten Sachbüchern und nicht selten auch im naturalistischen Mythos der naturwissenschaftlich erklärten (oder auch nur erklärbaren) physischen Welt antreffen (etwa bei Richard Dawkins).
Der Schlüssel zu einer umfassenderen und grundlegenderen Sicht der Wirklichkeit liegt nach Vogelsang in unserer leiblichen Existenz; hier schließt er an die Phänomenologie des französischen Philosophen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) an. Die Verflechtung von wahrnehmendem Subjekt und wahrgenommener Welt wird in der Tat kaum irgendwo greifbarer als in der Erfahrung des eigenen Körpers, in welcher dieser offensichtlich etwas anderes ist als ein objektiver Organismus. Viele objektiv beobachtbare physiologisch-anatomische Vorgänge in diesem Organismus bleiben seinem Besitzer völlig verborgen (z.B. Hirnzustände); umgekehrt kann die persönliche Erfahrung des Leibes nicht anatomisch-physiologisch entdeckt werden.
Dieser letzte Satz ist rhetorisch ein Beispiel für einen Chiasmus, d.h. die kreuzweise Gegenüberstellung von Gegensätzlichem, die in der verwendeten rhetorischen Figur jedoch als unbedingt zueinander gehörig gekennzeichnet werden: Der gesamte Satz ist zutreffender als jeder der beiden gegensätzlichen Teilsätze. Merleau-Ponty nutzte diese Figur in seinem Spätwerk, das er jedoch nicht mehr ausführen konnte, um beispielsweise die Verflochtenheit des Sichtbaren und des Unsichtbaren im Sehen zum Ausdruck zu bringen (vgl. Das Sichtbare und das Unsichtbare, 1964). Jacques Derrida (1930-2004) hat den Gedanken des „Dazwischen“ im Hinblick auf die Chora – nach Platons Dialog Timaios das „dritte Geschlecht“ zwischen dem Sinnlichen und dem Intelligiblen, welche alles empfängt, aber nichts annimmt und so zum ortlosen, nicht hintergehbaren ersten Ort der Philosophie überhaupt wird – noch weiter getrieben.
Vogelsang nutzt die Figur des Chiasmus von Subjekt (Bewusstsein) und Objekt (Ding) als Schema zur Darstellung ihrer unauflöslichen Verflochtenheit. Es handelt sich dabei um ein epistemisches Modell, das es erlauben soll, den Spielraum möglicher menschlicher Erfahrungen möglichst nicht durch metaphysische Vorurteile vorschnell einzugrenzen oder bestimmte Erlebnismöglichkeiten von vornherein auszuschließen. Der Autor geht dazu noch einen weiteren, entscheidenden Schritt zurück und beginnt nicht bei Subjekt (Ich) und Objekt, sondern bei dem, was sich zeigt. Die Gesamtheit dessen, was sich überhaupt zeigt, kann dann in dem vorgeschlagenen Chiasmus angeordnet werden. Im sich Zeigen der Phänomene ist das einfache Schema von innen (mental) und außen (dinglich) im Prinzip überwunden: Gedanken zeigen sich genauso wie sich mein Fuß zeigt; letzteres zeigt sich nicht „außen“, und ersteres zeigt sich nicht „innen“.
Der Chiasmus hat dabei die Form des Buchstaben X (griechisch = chi), wobei die beiden Linien des X für Subjektives und Objektives stehen. Sagen wir, die Linie des X von oben links nach unten rechts stehe für das Subjektive, und die Linie des X von unten links nach oben rechts stehe für das Dinglich-objektive. Im Chiasmus werden Subjektives und Objektives als unauflöslich miteinander verschränkt dargestellt: aus zwei Linien wird ein Buchstabe X; in diesem Modell ist die strikte Trennung und Gegenüberstellung des Subjektiven und Objektiven bei Descartes also überwunden (vgl. Abbildungen S. 173 und S. 181).
Während die Verschränkung stets unaufhebbar bleibt, kann man sich innerhalb des Schemas nach links oder nach rechts bewegen. Deutet man die beiden Linien als absteigende und ansteigende lineare Funktionen findet man ganz links eher subjektive Phänomene (z.B. Gedanken) und ganz rechts eher die physischen Dinge (z.B. die Tastatur, auf der ich gerade tippe) als Erscheinungsformen; die extremen Enden des Chiasmus entsprechen demnach dem cartesischen Modell.
Spannend wird es im Kreuzungspunkt des X, der bei Descartes bewusst ausgeklammert und bei Derrida als Chora entfaltet wird. (Bei Merleau-Ponty ist der Kreuzungspunkt dagegen der ortlose Ort eines Ineinanderumschlagens, welcher als solcher nicht greifbar ist.) Hier sind ja das Dingliche und das Subjektive in einem ähnlichen Mischungsverhältnis anzutreffen. Offensichtlich ist der Leib hierfür das Paradebeispiel: Beschreiben Sie doch einmal die Empfindung einer Berührung Ihrer beiden Hände oder das Gefühl, wenn sie das nächste Einatmen bis an den Punkt absoluter Unvermeidlichkeit hinauszögern! Das Leibliche – überhaupt der Kreuzungsbereich bzw. Mittelpunkt des Chiasmus – ist mit dem Wunsch Descartes, clare et distincte zu erkennen, kaum vereinbar: Der Leib als „das Wohnzimmer“ des Phänomenologen ist „die Horrorkammer“ des cartesischen Naturalisten. Unsere technisierte Kultur vernachlässigt den Leib, weiß ihn nicht zu kultivieren. Der heutige Körperkult beweist dies paradoxerweise; denn dem Körperkult geht es eher um den Körper als sichtbares, gestaltbares Ding, während es im Kreuzungspunkt des Chiasmus um den Leib als eine Fühlsphäre geht, die in eigenartiger Verflochtenheit von Innen und Außen, Subjekt und Objekt erfahren wird. Vogelsang bezieht sich auf den Kieler Philosophen Hermann Schmitz (*1928), wenn er diesem Zwischenbereich vor allem die Wahrnehmung von „Gefühlen“ und „Atmosphären“ zuschreibt.
Es lässt sich nun ontogenetisch (und wohl auch kulturgeschichtlich) zeigen, dass der Mensch ursprünglich aus der Fühlsphäre des Kreuzungspunktes von subjektiven und objektiven Phänomenen kommt und diese in beide Richtungen durch Kultur und Bildung immer weiter voneinander trennt, um größere begriffliche Klarheit zu gewinnen; das Schema wird sozusagen im individuellen und kulturellen Lebensvollzug immer weiter nach links und nach rechts gedehnt. Logik und Mathematik sind Beispiele für eine maximale „Objektivierung“ der Gedanken als sich subjektiv zeigenden Phänomenen; die Naturwissenschaften erschließen uns die vermeintlich rein dingliche Welt. In einem späteren Kapitel (9) wird – wiederum mit Bezug auf H. Schmitz – ausgeführt, dass wir in der Lebenswelt beispielsweise zu Artefakten keinesfalls ein rationales, getrenntes Verhältnis pflegen: Man muss sich nur einmal einen Ingenieur anschauen, wie er nach Feierabend in seinen geliebten Audi einsteigt.
Vogelsang entfaltet im weiteren Fortgang seiner Überlegungen die Grundidee sozialphilosophisch und bezieht sich dabei besonders auf den amerikanischen Philosophen George Herbert Mead (1863-1931). Phänomenologische Ansätze tendieren ja zu einem gewissen Solipsismus; insofern ist die Frage, wie der Andere (als Anderer meiner selbst) und das Andere in den Blick kommen, von zentraler Bedeutung. Vogelsang schließt sich der Auffassung Meads an, dass nicht Individuen soziale Gemeinschaften hervorbringen, sondern umgekehrt soziale Gemeinschaften Individuen, denen sich dann in Subjekt-Objekt-Verschränkungen die Wirklichkeit erschließt – auch Individuum und Gesellschaft sind chiasmatisch verflochten.
Hintergrund dieser Überlegungen sind die drei Vermittlungsweisen (Medien) der chiasmatischen Wirklichkeitserschließung: Wahrnehmen, Handeln und Sprechen. Bei Mead ist das Handeln von zentraler Bedeutung, auch Wahrnehmung wird letztlich als Handlung gedeutet; bei Merleau-Ponty steht die Wahrnehmung im Vordergrund – offensichtlich sind auch Wahrnehmung und Handeln miteinander verflochten (vgl. Sensuomotorik). Das Handeln muss nach Mead von vornherein als Handeln in sozialen Gemeinschaften gedeutet werden: soziales Handeln wird somit zum Konstitutiv jeder Weise der Wirklichkeitserschließung.
Erhellend im Hinblick auf den ursprünglichen Chiasmus von Bewusstsein und Ding ist nun, dass die Vermittlungsformen erst zu den Rändern links und rechts hin zunehmend relevant werden: Logik/Mathematik und Naturwissenschaft sind geprägt durch die schärfsten Formen von Wahrnehmung (nämlich objektive Beobachtung), Handeln (nämlich das Experiment sowie die Technologie) und Sprache (nämlich die Eindeutigkeit der mathematischen Weltbeschreibung). Im Kreuzungspunkt dagegen werden diese Medien unscharf (fuzzy): Der Leib ist ein eigenartig aktiv-passives „Ding“, ihn zu fühlen in seiner Umgebung mit ihrer eigentümlichen Atmosphäre entzieht sich der Beschreibung – oder verlangt zumindest dichterisches Talent (wie bei H. Schmitz).
Neben der Frage nach dem Anderen stellt sich die Frage nach der Wahrheit – auch hier könnte ein phänomenologischer Ansatz in einen Relativismus oder Konstruktivismus münden, der mit der kaum zu leugnenden Möglichkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnis nur schwer vereinbar wäre. Wenn ein Gedanke sich zeigt, ist er noch lange nicht zutreffend. Aber phänomenologisch wird die Idee einer Wirklichkeit, die an und für sich existiert und mit der unsere Aussagen korrespondieren könnten, abgelehnt: „Das Erkennen, das die Endlichkeit und das Beteiligtsein des Erkennenden berücksichtigt, hat aber keine Möglichkeit, ein ‚Original’ jenseits der Erscheinungsweise, ein ‚an sich’ als Korrektiv zu erschließen. Damit gibt es auch kein unabhängiges normatives Kriterium mehr dafür, welches Phänomen wahr ist.“ (S. 339) Wie gewinnt man aber ein Wahrheitskriterium, wie lässt sich im Rahmen des von Vogelsang vorgeschlagenen phänomenologischen Realismus die Differenz zwischen Wahrheit und Irrtum denken, wenn man auf starke metaphysische Begriffe wie Wirklichkeit und Sein verzichtet? Vogelsang plädiert im Anschluss an den amerikanischen Philosophen Hilary W. Putnam (*1926) für einen internal realism, und so heißt es im Weiteren: „Die Unterscheidung von Wahrheit und Irrtum können [sic!] sich nur innerhalb der Erscheinungsweisen der Wirklichkeit selbst erweisen.“ (S. 339) Die Bedeutung eines Begriffs oder eines Satzes lässt sich nicht mehr erschließen, wenn man Bewusstsein und Welt, Sprache und Beschriebenes (dualistisch) streng voneinander getrennten Sphären zuschreibt. Beispielsweise sind die Begriffe innerhalb einer Computersprache absolut eindeutig definiert – am Ende aber bleiben sie rein algorithmische Begriffe ohne Semantik, und der Computer bleibt eine logische Maschine ohne Weltbezug – oder in Putnams Worten: „Bedeutungen sind, im Gegensatz zu einer seit dem 17. Jahrhundert obwaltenden Theorie, nicht im Kopf.“ (Vernunft, Wahrheit und Geschichte, 1990) Putnam und auch Vogelsang wählen die Wittgensteinsche Alternative: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ (Philosophische Untersuchungen, 1953, Nr. 43) Wahrheitskriterien sind demnach Kohärenz und Bewährung.
Vogelsang führt im Anschluss an Putnam weiter aus, dass die Wahrheitskriterien der Wissenschaft ihrerseits in Wertorientierungen begründet sind, die erst die Werte erschließen, denen sich die Wissenschaft verpflichtet weiß. Vogelsang spricht hier von Wahrhaftigkeit und gründet den Wahrheitsanspruch letztlich im Kreuzungspunkt des Chiasmus selbst: Wahrheit erschließt sich fundamental leibhaftig als Gefühl und Atmosphäre. Merleau-Ponty spricht in diesem Zusammenhang gar vom Wahrnehmungsglauben: „Nun, diese nicht zu rechtfertigende Gewissheit einer gemeinsamen sinnlichen Welt ist der Sitz der Wahrheit in uns“ (Das Sichtbare und das Unsichtbare, S. 28); und dieser „Sitz der Wahrheit“ kann nicht nochmals hinterfragt werden (vgl. die Chora bei Derrida als Ursprung aller Philosophie). Der österreichisch-britische Philosoph Sir Karl R. Popper (1902-1994) spricht im selben Zusammenhang vom Glauben an die Vernunft, welcher seinerseits zwar vernünftig sein mag, sich jedoch nicht noch einmal selbst vernünftig (letzt)begründen kann.
Vogelsang beschließt sein Buch mit einem „Plädoyer für eine Kultur der Achtsamkeit“. Insbesondere die von der Philosophie sträflich vernachlässigten Phänomene im Kreuzungspunkt des Chiasmus – Leiblichkeit, Atmosphären, Gefühle usw. – verdienen als Quellen von Sinn, Werthaftigkeit und Wahrheitsstreben und somit als Quellen der Philosophie und der Wissenschaft selbst unsere Aufmerksamkeit. Lebenswelt und Wissenschaft müssen wieder stärker auf Tuchfühlung zueinander gebracht werden.
Ich komme zu einer kritischen Beurteilung.
Ich finde das Buch sehr klar und verständlich geschrieben; man findet gute Einführungen in die Kerngedanken bei Descartes, Dennett, Merleau-Ponty, Putnam und Schmitz in einem schlüssigen Zusammenhang. Ich muss allerdings einschränkend zugeben, dass ich selbst viel zu wenig in der Philosophie bewandert bin, als dass ich die knappen Darstellungen dieser Philosophen wirklich beurteilen könnte. Seine eigenen Überlegungen entfaltet Vogelsang in einem nachvollziehbaren Bezug auf die genannten Philosophien, bietet aber doch eine ganz eigene Sicht der Dinge; keinesfalls bleibt er nur Exeget.
Ich selbst habe sehr viel Sympathie mit vielen Aspekten des vorgetragenen Gedankengangs. Allerdings muss man sagen, dass sich diese Philosophie an einem Gegner abarbeitet, dessen gänzlich fehlendes Verständnis für Dialektik und die Eigentümlichkeit des Subjektiven ihn eigentlich bereits für eine ernsthafte Auseinandersetzung desavouiert. Man muss daher fragen: Welcher philosophische Ertrag wird am Ende durch die einleuchtende Erinnerung an Leib, Gefühl und Atmosphäre erzielt? Kommt man – im Hinblick auf die Beurteilung von Naturwissenschaft – phänomenologisch wirklich über Kant und die Dialektik hinaus? Und in praktischer Hinsicht: Sollte Kultur vor allem eine Bewegung der fortwährenden weiteren Ausdehnung des Chiasmus an dessen extremen Enden sein – wie soll dann die Kultivierung der Chora in der Mitte des Chiasmus konkret aussehen? Sieht Vogelsang (als Theologe) hier eine Aufgabe der Religion(en) mit ihren spezifischen, weder logischen noch dinglichen Wahrnehmungen (z.B. Meditation, Mystik), Handlungen (Liturgien, Trance) und Sprachen (Mythos, Metapher, Symbolik)? Ich bin jedenfalls schon jetzt gespannt auf das nächste Buch meines Freundes, indem er die Karten auf den Tisch legt und auf der Basis des phänomenologischen Realismus seine Theologie formuliert!
Die Rolle des Gehirns für die Erschließung von Wirklichkeit in Wahrnehmung, Handlung und Sprache wird kaum erörtert; bei den Überlegungen zu Dennett und Putnam klingt die Problematik am Rande an. Das Gehirn zeigt sich ja nun gerade nicht, es ist Teil des Organismus, aber nicht Teil der Leiberfahrung! Es liegt in der Natur der Sache, dass genau dieser – meines Erachtens zentrale – Aspekt nicht phänomenologisch (oder introspektiv, oder meditativ), sondern ausschließlich naturwissenschaftlich erschlossen werden kann: Ausschließlich mit Hilfe wissenschaftlicher Untersuchungsverfahren können wir irgendetwas über unsere Gehirne in Erfahrung bringen. Sicher ist mein Gehirn nicht einfach eines der Dinge am rechten Rande des Chiasmus wie die anderen auch; es ist etwas fundamental Anderes als mein Computer oder mein Fuß; und sicher ist es auch kein Gedanke. Ich habe überhaupt kein Verhältnis zu meinem Gehirn – hätte ohne es aber zu nichts und niemand ein Verhältnis (Chiasmus!): Bei der Narkose endet die Wirklichkeitserschließung für den Narkotisierten nach wenigen Sekunden infolge einer chemischen Einwirkung auf die Hirnfunktion. Mich fasziniert, dass ein Stück naturwissenschaftlich erforschbarer Materie aus Wasser, Fett und Eiweiß in meinem Kopf die notwendige (und wohl auch hinreichende) Voraussetzung dafür sein kann, dass ich als Person eine Welt erfahren und zu ihr in ein geistiges (z.B. wissenschaftliches) Verhältnis treten kann. (Ist mir mein Gehirn am Ende der ortlose Ort, die Derridasche Chora?)
Ich bin mit dem Wirklichkeitsbegriff des phänomenologischen Realismus noch nicht völlig einverstanden. Mir scheint, die Preisgabe des klassischen metaphysischen Begriffs der Wirklichkeit (des Seins) in fast allen modernen Strömungen der Philosophie hat kein einziges Problem gelöst, sondern führt nur zu einer andauernden Begriffsverwirrung zwischen Wirklichkeit und Wissen; modern heißt nun einmal nicht automatisch besser. Es ist keine Frage, dass wir unser Wissen durch Bewährung und Kohärenz kritisch prüfen können; doch selbst wenn es sich bewährt und es intern kohärent ist, muss es noch lange nicht wahr sein – dies ist uns zutiefst bewusst, gerade auch in den Naturwissenschaften. Die Fallibilität des Denkens zu denken – und nichts anderes ist kritisches Denken – verlangt nach einem starken, hintergründigen Wirklichkeitsbegriff, der strikt von unserem Wissen und Denken unterschieden bleibt: Unser Denken arbeitet sich ab und bemisst sich an einer Wirklichkeit, welche es sich nicht ausdenkt, auf die es aber ausschließlich denkend „zugreifen“ kann – ohne sie in den Griff zu bekommen. Im Denken dieser Wirklichkeit muss ich die Differenzen, die dieses Denken überhaupt erst ermöglichen, schon mitdenken: Ich vs. der/das Andere (Erkennen); das Jetzt unmittelbaren Erlebens vs. die Zeit (Geschichte); die Beschreibung vs. das Beschriebene (Denken). Diese Differenzen sind keine Gegenüberstellung, keine Gegensätze; Unterscheidung bedeutet nicht Trennung. Die dialektische Figur des Chiasmus ist hier sehr anschaulich und hilfreich: Wir sind mit dieser Wirklichkeit verflochten, wir sind aber nicht die Wirklichkeit.
Ich selbst bevorzuge ein dreiwertiges Schema: In der Einheit des Erkennens sind der Erkennende, seine Erkenntnis und das Erkannte voneinander unterschieden und nicht aufeinander reduzierbar. Die Möglichkeit dieser dreieinigen geistigen Struktur eines Wirklichkeitsbezugs, letztlich: die Möglichkeit von Personalität, muss ich von Anbeginn der Welt und vor aller Zeit denken, da sich deren geschichtlich gewordene Wirklichkeit – Naturalismus hin oder her – nicht ohne performativen Selbstwiderspruch leugnen lässt. (Man kann sich natürlich weigern, nach den Bedingungen der Möglichkeit von Personalität in einer physischen Welt zu fragen.) Christlich-theologisch erschließt sich Personalität (mit einem gegenüber Wahrnehmung und Denken stärkeren Wirklichkeitsbegriff) als Hineingenommensein des Menschen in die alles Sein und Erkennen begründende dreeinige Wirklichkeit, und zwar mitten im alltäglichen Lebensvollzug, im tätigen Weltbezug. Religiös wird diese Wirklichkeit Gott genannt und in dieser Anrede (nicht im abstrakten Diskurs darüber) vor das Bewusstsein des Beters gebracht, der sich dabei aber stets in dieser unverfügbaren Wirklichkeit weiß; denn auch dadurch dass man diese Wirklichkeit Gott nennt, wird sie kein weiteres Wirkliches, das es auch noch in der Welt gibt.
Paulus von Tarsus hat dasselbe den Athenern seinerzeit viel schöner gesagt: „Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas: er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. … Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten; denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben: Wir sind von seiner Art.“ (Apg 17.28)


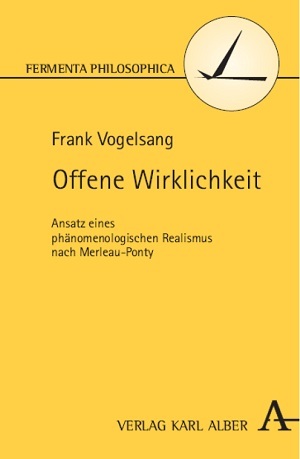
Ich kann die Argumentation überhaupt nicht nachvollziehen. Das sind die typischen Argumentationen von Geisteswissenschaftlern.
Es gibt keinen ernstzunehmenden Grund warum Subjektivität nicht in der Objektiven Welt eingebettet sein sollte.
Bspw. beschreiben sie, dass Objektivität und Subjektivität nichts miteinander zu tun hat in der cartesischen Welt. Das ist aber einfach falsch. Das mag Descartes im 17.Jhdt gedacht haben, aber das reduktionistische Naturalistische Weltbild von heute durch Descartes von 16xx zu widerlegen ist geradezu lächerlich.
In diesem modernen Weltbild ist Subjektivität und Objektivität teil ein und der selben Welt, nämlich einer Objektiven.
Weiter wird zum Beispiel gesagt: “umgekehrt kann die persönliche Erfahrung des Leibes nicht anatomisch-physiologisch entdeckt werden.”
Das ist schlicht und einfach falsch. Es geht sehr wohl. Es gibt keinen das anzunehmen, aber tausend Gründe das Gegenteil anzunehmen.
Es gibt keinen Grund das anzunehmen, aber tausend Gründe das Gegenteil anzunehmen.
heißt es natürlich
Oder die Behauptung, dass Mathematik und Naturwissenschaften objektiv seien…
Das ist auch schlicht und einfach falsch in diesem Kontext. Alles aber auch alles in der Mathematik und Physik ist in diesem Zusammenhang subjektiv. Das objektivste Element darin ist die Falsifikation, die die Physik zu dem reduziert was sie ist. Ein negativer Erkenntnisgewinn. Die umformulierung dieses negativen Erkenntnisgewinns in positivistische Hypothesen – das was wir eigentlich Physik nennen würden – ist auch subjektiv. Der einzige Unterschied zu anderen subjektiven Entscheidungen die wir als Mensch treffen, liegt in der Falsifikation. etc.pp.
Buddhismus
Es wäre wünschenswert, wenn in solche Überlegungen auch die Erkenntnisse budhistischer Philosophie einbezogen würde.
Buddhisten haben manche Fragestellungen schon gelöst, die für europäische Philosophen noch unerklärbar sind.
Zitat.
„Vogelsang erblickt in der naturalistischen Tendenz, nur der (popularisierten) Naturwissenschaft Vernunft und Wahrheit zuzutrauen und die an Personen gebundenen Erscheinungsweisen des Wirklichen in die Sphäre des bloß Subjektiven abzuschieben, eine folgenreiche Verflachung unserer Sicht“
Na gut, dann muss ich zugeben, dass ich ein „Flachseher“ bin. Tatsächlich traue ich nur Naturwissenschaftlern so was zu, wie das hier, nämlich dass ich über die Tastatur meine Gedanken eingeben kann und fast sofort die ganze Welt sie lesen kann.
Sowas bringen nun mal keine Theologen und Philosophen zustande.
Und ich wüsste auch nicht, wo irgendwelche Gedanken von Philosophen und Theologen mein Leben beeinflusst oder gar bereichert hätten.
Naturwissenschaftler krempeln mein Alltagsleben ständig um!
“Ich habe überhaupt kein Verhältnis zu meinem Gehirn – hätte ohne es aber zu nichts und niemand ein Verhältnis.”
Sehr schön auf den Punkt gebracht.