Wilhelm Krull: Neue Chancen für die Geisteswissenschaften
BLOG: GUTE STUBE

Zum vorerst letzten Mal besucht uns Wilhelm Krull heute in der Guten Stube. Nachdem er sich zuvor im Einzelnen zu den Dimensionen Innovation, Interdisziplinarität, Internationalität und Infrastruktur geäußert hat, bringt er nun seine Vision einer zukünftigen Rolle der Geisteswissenschaften noch einmal auf den Punkt. Vielen Dank für Ihre Gedankenanstöße, Dr. Krull!

Fazit: Neue Chancen für die Geisteswissenschaften
In einer zunehmend auch im Hochschul- und Forschungsbereich globalisierten Welt kommt dem Wissen eine immer größere Bedeutung zu. Das heute nahezu simultane Herstellen, Aufbereiten und Vermitteln von neuem Wissen macht zugleich ein neues Selbstverständnis von Wissenschaft und Forschung notwendig: von einem homogen strukturierten, durch innerwissenschaftliche Diskurse geprägten, institutionell fest verankerten Prozess hin zu offeneren, oft durch außerwissenschaftliche Fragestellungen angestoßenen und durch dezidierten Gesellschaftsbezug sowie problembezogenes methodisches Vorgehen geprägten Verfahren.
Dass sich die kontinentaleuropäischen Geistes- und Naturwissenschaften vor diesen Veränderungen zu lange versteckt haben, hatte seinen guten Grund: Die als Vorbild dienende deutsche Forschungsuniversität und ihre disziplinäre Spitzenforschung machte Deutschland im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer weltweit führenden Wissenschaftsnation. Doch schon seit den 1890er Jahren begann die wissenschaftliche Entwicklung vor allem in den naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen, die seit Humboldt zur Alleinideologie erhobene Einheit von Forschung und Lehre zu sprengen. Das zunehmende Unvermögen der Institution Universität, den sich ihr stellenden Aufgaben – humanistische Menschenbildung, berufliche Fachbildung und wissenschaftliche Forschung – gleichermaßen gerecht zu werden, so schreibt Bernhard vom Brocke in seinem Aufsatz über die Entstehung der deutschen Forschungsuniversität [1], bewirkte eine ständig wachsende Diskrepanz zwischen der Universitätsidee des Neuhumanismus und der tatsächlichen Hochschulstruktur.
Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren also die bis heute virulenten Probleme des kontinentaleuropäischen Hochschulsystems im Kern vorgezeichnet: Die unzureichende Berücksichtigung neuer Disziplinen im Rahmen der traditionellen Universitätseinteilung, die zunehmende Spezialisierung auf allen Gebieten, die Unmöglichkeit interdisziplinären Forschens innerhalb der gegebenen und von den Professoren zumeist vehement verteidigten Strukturen sowie die nicht zuletzt auch daraus resultierende Explosion der Kosten in den Natur- und Technikwissenschaften, die sich dann wiederum auf Einsparnotwendigkeiten in den Geisteswissenschaften negativ auswirkten.
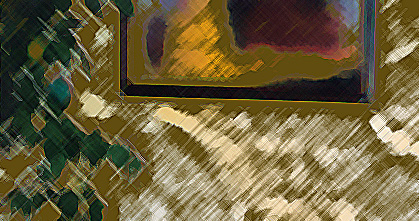
Der fraglos berechtigte Stolz über ein früher vorbildliches und produktives Hochschulsystem ist zu einer kontraproduktiven Mentalität der Besitzstandswahrung, zu einer Blindheit gegenüber der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Realität geworden. Deshalb erscheint es umso dringlicher, nun – trotz vielfacher Belastungen im Hochschulalltag – den Blick nach vorne zu richten auf neue Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade vor dem Hintergrund der geschilderten Globalisierungsprozesse können die Geisteswissenschaften im institutionellen Kontext der sich weiter internationalisierenden Universitäten durchaus profitieren. Dazu müssten sie jedoch bereit sein, sich stärker als bisher in aktuelle Debatten und Ausbildungserfordernisse einzumischen.
Trotz der zweifellos in vielen Massenuniversitäten schwierigen Situation der Geisteswissenschaften bietet sich an allen Ecken und Enden ein breites Portfolio neuer Chancen.
[1] Bernhard vom Brocke: Die Entstehung der deutschen Forschungsuniversität, ihre Blüte und die Krise um 1900. In: Humboldt International. Der Export des deutschen Universitätsmodels im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von Rainer Christoph Schwinges. Basel: Schwabe & Co. 2001. S.367-401.
Dieser Gastbeitrag ist der abschließende Teil einer Kommentarserie von Wilhelm Krull:
Neue Chancen für die Geisteswissenschaften
Teil 1: Innovation
Teil 2: Interdisziplinarität
Teil 3: Internationalität
Teil 4: Infrastruktur
Teil 5: Fazit: Neue Chancen für die Geisteswissenschaften


Welche Chancen?
Konkret geworden, sehr geehrter Herr Krull, habe ich die “neuen Chancen” nur im ersten Teil Ihres Essays finden können, wo von vorbeugendem Denken und der Erhöhung des Reflexionspotentials der Gesellschaft die Rede ist.
Nun, ich würde sofort unter beide Schlagwörter meine Unterschrift setzen wollen — aber frage mich immer wieder, ob dafür in der Wissensgesellschaft wirklich ein Platz ist. Manchmal muss man einfach zu dem Ergebnis kommen, dass interdisziplinäre Brücken auf wackeligem Holz gebaut sind, dass sie manche Projekte inhaltlich nicht tragen und dass man vieles nicht oder noch nicht genau genug weiß, um starke Aussagen zu stützen. Dieser Haltung sehe ich in Publikationen aber kaum bis gar nicht Rechnung getragen; wer will schon als Spielverderber gelten? Und meines Erachtens reicht es nicht, dass sich (zum Beispiel) ein Physiker und ein Philologe gemeinsam an den Tisch setzen und jeder über seine Disziplin spricht, um damit Interdisziplinarität zu begründen.
Freilich multiplizieren sich durch interdisziplinäre Forschung die Publikationsmöglichkeiten — aber was, wenn man etwa zu dem Ergebnis kommt (und das idealerweise auch gut begründen kann), dass manche Ergebnisse eigentlich nicht publizierbar sind? Und wie misst man den Erfolg interdisziplinärer Forschung? An der Anzahl der Publikationen?
So sehr ich diese neuen Fördermöglichkeiten mit Langzeitperspektiven begrüße, und so sehr ich auch dankbar für die vielen Chancen der VWStiftung bin, bleibt bei mir doch die Skepsis, ob man als junger Wissenschaftler mit intedisziplinärer Forschung seiner Karriere wirklich etwas Gutes tut.
Das erinnert mich an eine Anekdote, für die John Searle einmal Benjamin Libet zitierte, als Bewusstseinsforschung wissenschaftlich noch nicht anerkannt war: It is okay to investigate consciousness — but get tenure first!
Ein erfrischender Beitrag!
…An dem vieles stimmt und der deswegen für Naserümpfen sorgen dürfte. Danke, Herr Krull!
@ Stephan
Du schriebst:
“So sehr ich diese neuen Fördermöglichkeiten mit Langzeitperspektiven begrüße, und so sehr ich auch dankbar für die vielen Chancen der VW-Stiftung bin, bleibt bei mir doch die Skepsis, ob man als junger Wissenschaftler mit intedisziplinärer Forschung seiner Karriere wirklich etwas Gutes tut.”
Das ist wirklich ein guter Punkt! Denn die Erfahrung machen vieler meiner Altersgenossen auch immer wieder – dass die viel beschworene Interdisziplinarität in der Praxis die Karrierechancen des akademischen Mittelbaus eher beeinträchtigt. Wehe dem Geistes- oder Kulturwissenschaftler, der mit Biologen die Zusammenarbeit sucht oder dem Naturwissenschaftler, der seine Befunde auch philosophisch durchdenken mag – das ruft eher Verwunderung, bei Resonanz bestenfalls Neid hervor, erhöht die Chancen im eigenen Fach aber kaum. “Sicherer” scheint es den Nachwuchswissenschaftlern daher (und wird ihnen ggf. auch so empfohlen) sich methodisch oder auch inhaltlich brav in den Bahnen der Vorväter zu bewegen und möglichst vielen noch lebenden Würdenträgern zu huldigen – schließlich wisse man doch nie, wer eines Tages die Berufungskommission bilde. Frei denken und forschen könne man ja vielleicht nach erfolgtem Ruf…
Das halte ich für einen gravierenden Systemfehler, weil er nicht nur die Interdisziplinarität, sondern auch die Innovation gerade unter Nachwuchskräften abwürgt. Und man kann ja Leuten Anfang / Mitte 30 mit allenfalls befristeten Verträgen und Kleinkindern zuhause kaum aktiv abverlangen, “dass sie doch mal riskieren”. So züchten wir genau die unkreative Konformität und das Denken in Fachgrenzen, das wir dann wortreich beklagen.
Entsprechend rate ich meinen Studierenden daher stets: Wenn Ihr wirklich mit Freude Wissenschaft betreiben und neue Dinge denken, forschen, tun wollt, sucht Euch früh einen Beruf außerhalb der Ochsentour. Vielleicht wird der Systemfehler ja irgendwann einmal behoben (z.B. durch zunehmend interdisziplinär besetzte Berufungskommissionen), aber bis dahin trainieren wir in Deutschland ausgerechnet unseren Nachwuchskräften Begeisterung, Innovation und (auch innere) Unabhängigkeit ab.